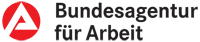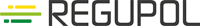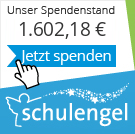Sie finden das hausinterne Curriculum zu Erziehungswissenschaft, Stand Oktober 2022 im angehängten pdf.
Wählen Sie durch Eingabe in den Titelfilter aus; z.B. 6 oder Deutsch
Pädagogik Erziehungswissenschaft SII EF Q1 Q2 inkl. Leistungsbewertung
- Clemens Binder
- Pläne und Orga
- Curricula
- Zugriffe: 7476